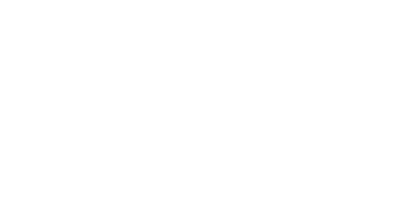Gefordert sind innovative Lösungen zur Lärmreduzierung!
Bedeutung der Bahn
Die Bahn als Verkehrsmittel im Nah- und Fernverkehr sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr, ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer modernen Gesellschaft. Sie ermöglicht es uns, schnell und effizient zu reisen, Güter zu transportieren und dabei einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes zu leisten. Doch trotz all ihrer Vorteile bringt die Bahn auch Herausforderungen mit sich, insbesondere in Form von Bahnlärm mit dem Risiko der gesundheitlichen Gefährdung, die auf ein Minimum zu reduzieren ist.
Ursache des Bahnlärms
Züge haben in der Regel einen Schallpegel zwischen 75 und 95 Dezibel (dB) und können in Ausnahmefällen einen Schallpegel von bis zu 100 Dezibel (dB) erreichen. Dies ist in etwa so viel wie ein Presslufthammer, der auf 90 dB kommt.
Bahnlärm entsteht durch verschiedene Quellen und Mechanismen, die miteinander interagieren. Die Hauptursachen lassen sich in folgende Kategorien einteilen:
Rollgeräusche:
Rollgeräusche sind die Hauptquelle des Bahnlärms bei mittleren bis hohen Geschwindigkeiten – etwa zwischen 50/60 km/h und 250 km/h. Sie entstehen durch die Interaktion zwischen Rad und Schiene, insbesondere durch Schwingungen beider Komponenten. Unregelmäßigkeiten an der Radlauffläche oder der Schiene (z. B. Riffel oder Flachstellen) können diese Geräusche deutlich verstärken.
Bei niedrigeren Geschwindigkeiten (unter 50 km/h) überwiegen meist die Antriebsgeräusche. Ab etwa 250 bis 300 km/h hingegen treten aerodynamische Geräusche (z. B. Luftverwirbelungen) stärker in den Vordergrund als die Rollgeräusche.
Erschütterungen und Sekundärschall / Körperschall: Bauteile der Infrastruktur können in Schwingung versetzt werden und dadurch Lärm erzeugen. Die Schwingungen werden als Körperschall über das Erdreich übertragen. Körperschall, der mit zunehmendem Abstand abnimmt, breitet sich im Erdreich wellenförmig aus und kann über das Fundament z.B. in ein Gebäude übertragen werden. Dies kann durch Resonanzeffekte verstärkt werden.
Aerodynamisches Geräusch: Bei hohen Geschwindigkeiten, besonders bei Hochgeschwindigkeitszügen, entsteht Lärm durch die Luft, die um den Zug herum und durch dessen verschiedene Teile strömt. Das aerodynamische Geräusch nimmt mit der Geschwindigkeit des Zuges zu und kann bei sehr hohen Geschwindigkeiten (ab 250-300 km/h) die dominierende Lärmquelle werden.
Antriebsgeräusche: Diese entstehen durch die Betriebssysteme des Zuges, wie den Motor, Getriebe, Klimaanlage, Durchsagen und weitere mechanische Komponenten. Bei älteren Zugtypen können diese Geräusche besonders auffällig sein.
Bremsgeräusche: Beim Bremsen können Züge erheblichen Lärm erzeugen, besonders wenn herkömmliche Klotzbremsen verwendet werden. Das Geräusch entsteht durch die Reibung zwischen den Bremsen und den Rädern oder der Schiene.
Schienenstoßgeräusche: In Bereichen, in denen die Schienen nicht nahtlos verschweißt sind, entstehen beim Überfahren der Stoßstellen klappernde oder schlagende Geräusche. Diese Art von Lärm wird mit der zunehmenden Verwendung von durchgehend geschweißten Schienen weniger häufig.
Brückenübergänge und Weichen: Beim Überfahren von Brücken oder Weichen kann es aufgrund der strukturellen Eigenschaften und der Übergänge zwischen den Schienenteilen zu zusätzlichem Lärm kommen.
Die Lärmbelästigung durch Züge hängt nicht nur von der Lärmquelle selbst ab, sondern auch von der Entfernung zur Schallquelle, der umgebenden Bebauung, der Topographie und den Wetterbedingungen.
Maßnahmen zur Lärmreduzierung zielen darauf ab, die verschiedenen Lärmquellen direkt an ihrer Entstehung oder an ihrem Ausbreitungsweg zu bekämpfen, etwa durch technologische Verbesserungen an Zügen und Schienen oder durch bauliche Schallschutzmaßnahmen.
Link zu Lösungen