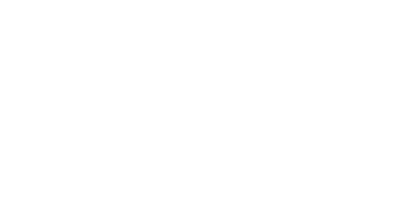Die Deutsche Bahn steht erneut an einem Wendepunkt: Vorstandschef Richard Lutz verlässt das Unternehmen mitten in einer Phase, die für die Zukunft des Schienenverkehrs in Deutschland entscheidend ist. Seit Jahren kämpft der Konzern mit Verspätungen, maroder Infrastruktur und hohen Verlusten – und die dringend notwendige Generalsanierung hat gerade erst begonnen. Wer die Nachfolge von Lutz antritt, übernimmt ein schweres Erbe und eine Dauerbaustelle, die Fahrgäste, Politik und Wirtschaft gleichermaßen betrifft.
Spekulationen über mögliche Nachfolgerinnen und Nachfolger laufen bereits auf Hochtouren – genannt werden unter anderem DB-Regio-Chefin Evelyn Palla, Ex-Finanzstaatssekretär Jörg Kukies und Siemens-Mobility-Chef Michael Peter. Doch egal, wer am Ende das Steuer übernimmt: Die Erwartungen sind enorm, der Handlungsspielraum dagegen begrenzt.
Die größte Herausforderung bleibt die Kundenzufriedenheit, die untrennbar mit Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit verbunden ist. Gleichzeitig müssen Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur koordiniert, die wirtschaftliche Schieflage korrigiert und ein möglicher Tarifkonflikt mit der GDL bewältigt werden. Hinzu kommt die enge Abhängigkeit von politischen Entscheidungen und Finanzmitteln, die über Tempo und Richtung der Reformen mitentscheiden.
Die kommenden Jahre werden also entscheidend dafür sein, ob die Bahn ihren zentralen Platz in der Verkehrswende einnehmen kann – oder ob sie weiterhin ein Symbol für Chaos, Verzögerungen und verpasste Chancen bleibt.
Mit dem Abgang von Bahnchef Richard Lutz verliert die Deutsche Bahn ihre bislang wichtigste Führungsfigur – und das mitten in der laufenden Generalsanierung des Schienennetzes. Wer seine Nachfolge antreten wird, ist noch unklar, doch die Aufgaben für den neuen Vorstandsvorsitzenden sind gewaltig. Im Gespräch sind sowohl erfahrene Bahnmanagerinnen wie Evelyn Palla, politische Schwergewichte wie Jörg Kukies als auch Industrievertreter wie Michael Peter. Klar ist: Der Wechsel an der Spitze allein löst keines der strukturellen Probleme, sondern markiert lediglich den Auftakt für eine Reihe von Prüfungen, die das Unternehmen in den kommenden Jahren meistern muss.
1. Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit
Das Hauptärgernis für die Fahrgäste bleibt die mangelnde Pünktlichkeit. Im Fernverkehr schaffen es derzeit nicht einmal zwei Drittel der Züge, ihre Halte rechtzeitig zu erreichen. Verspätungen, Ausfälle und überfüllte Züge prägen den Alltag, während auf weniger nachgefragten Strecken das Angebot oft zu gering ist. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder kündigte eine „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ an, die am 22. September vorgestellt werden soll. Darin geht es nicht nur um Pünktlichkeit, sondern auch um Sauberkeit, Sicherheit und eine effizientere Unternehmensführung. Der neue Bahnchef wird maßgeblich an dieser Strategie gemessen werden – und steht von Beginn an unter Druck.
2. Infrastruktur und Generalsanierung
Ein zentrales Problem ist das marode Schienennetz, das seit Jahrzehnten unterfinanziert ist. Die Bahn hat daher ein Programm gestartet, um rund 40 besonders belastete Strecken bis 2036 vollständig zu erneuern. Statt Flickwerk im laufenden Betrieb setzt man auf monatelange Vollsperrungen, um Modernisierungen gebündelt umzusetzen. Erste Projekte wie die Riedbahn oder die Strecke Hamburg–Berlin zeigen, dass dieser Ansatz zwar effizient ist, aber für die Fahrgäste massive Einschränkungen mit sich bringt. Kritiker warnen vor den Folgen für den Verkehr, doch grundsätzlich gilt das Konzept als notwendiger Schritt. Für den neuen Vorstandsvorsitzenden bedeutet das: Er muss den eingeschlagenen Kurs nicht nur fortführen, sondern auch die dafür nötigen Finanzmittel langfristig sichern.
3. Politische Abhängigkeit und Finanzierung
Die Bahn ist stark auf die Unterstützung der Politik angewiesen. Jahrzehntelange Vernachlässigung hat einen Investitionsstau in zweistelliger Milliardenhöhe entstehen lassen. Zwar hat der Bund die Zuschüsse zuletzt erhöht, doch auch diese Mittel reichen nicht aus, um die Bahn nachhaltig fit zu machen. Der Fokus liegt derzeit auf der Sanierung des Bestandsnetzes – doch für die ambitionierten Ziele des Deutschlandtakts mit halbstündlichen Verbindungen auf den Hauptachsen wären erhebliche zusätzliche Investitionen nötig. Grünen-Verkehrspolitiker Matthias Gastel fordert daher eine engere Kontrolle durch den Bund sowie eine verlässliche Finanzierung, die nicht von kurzfristigen Haushaltsentscheidungen abhängt.
4. Wirtschaftliche Lage des Konzerns
Parallel zur technischen Erneuerung kämpft die Bahn mit roten Zahlen. Das 2024 von Lutz angestoßene Sanierungsprogramm sieht nicht nur Investitionen in Infrastruktur vor, sondern auch einen Umbau des Konzerns selbst. Tausende Stellen sollen abgebaut, die Profitabilität gesteigert werden. Besonders kritisch ist die Lage bei DB Cargo: Die Güterverkehrstochter ist seit Jahren defizitär und steht unter Druck, spätestens 2026 wieder schwarze Zahlen zu schreiben – eine Auflage der EU im Rahmen eines Beihilfeverfahrens.
Das größte Problem ist der Einzelwagenverkehr, bei dem Waggons einzeln bei Firmen abgeholt und aufwendig zu Zügen zusammengestellt werden. Trotz staatlicher Förderung bleibt dieses Geschäft defizitär, ist aber für Branchen wie Stahl und Chemie unverzichtbar. Ein Rückzug der DB Cargo würde Tausende zusätzliche Lkw-Fahrten verursachen und die Klimaziele gefährden. Der neue Bahnchef muss hier zwischen wirtschaftlicher Vernunft und klimapolitischer Verantwortung abwägen.
5. Tarifkonflikte mit der GDL
Ein weiteres Risiko droht aus den anstehenden Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Der bisherige Tarifvertrag läuft zum Jahresende aus, und auch wenn der neue GDL-Chef Mario Reiß moderater auftreten könnte als sein Vorgänger Claus Weselsky, ist mit harten Verhandlungen zu rechnen. Streiks mit massiven Zugausfällen würden insbesondere zum Amtsantritt eines neuen Vorstandschefs ein fatales Signal senden und die ohnehin angespannte Lage bei Fahrgästen und Öffentlichkeit verschärfen.
Fazit
Die Aufgabenliste für den Nachfolger von Richard Lutz ist lang: Kundenzufriedenheit steigern, Pünktlichkeit verbessern, Milliardeninvestitionen koordinieren, wirtschaftliche Stabilität herstellen und Tarifkonflikte entschärfen. Zugleich muss er das Vertrauen der Politik gewinnen, um langfristige Finanzierungen zu sichern. Fest steht: Die Deutsche Bahn bleibt auf absehbare Zeit eine Dauerbaustelle – und die neue Führung wird den Kurs entscheidend prägen, ob sie zum Motor der Verkehrswende oder weiter zum Sorgenkind der deutschen Infrastruktur wird.
Artikel in der FAZ vom 15.08.25